

Zuzüglich Portokosten: Deutschland: 1,30 EUR Porto pro Heft Schweiz: 1,80 EUR pro Heft Österreich 2,90 EUR pro Heft |
Zauberreich der Pilze - Spektrum Homöopathie 01/2015
Zauberreich der Pilze Pilze existieren überwiegend im Verborgenen, unter der Erde oder im Inneren anderer Organismen. Auch in der Homöopathie werden bisher nur wenige Vertreter dieses Naturreiches sichtbar, ihre Zuordnung ist ein Schwerpunkt von SPEKTRUM 1-2015: Drei passgenaue Schlüssel für das Zauberreich der Pilze liefern die holländische Masi-Gruppe, Jan Scholten mit seiner neuen Pflanzentheorie und die Empfindungsmethode, dargestellt von Jörg Wichmann, Angelika Bolte und Ruth Wittassek. Alle drei Perspektiven ergänzen und durchdringen sich und vermitteln in der Synopse ein plastisches homöopathisches Bild dieses faszinierenden Naturreiches, das mit seinen Charakteristika und Themen auch noch unbekannte Pilzarzneien künftig in der Praxis erkennbar machen wird. Pilze und ihr Wirkungsspektrum - ob als Darmsymbionten oder Krankheitserreger, als Rausch- oder Heilmittel, als Speise- und Giftpilze – versprechen breite, bisher noch viel zu wenig genutzte Anwendungsmöglichkeiten in der Homöopathie: SPEKTRUM bringt einige neue spannende Prüfungsberichte inklusive interessanter Fallgeschichten. Dabei bietet der Beitrag von Bob Blair zu Cryptococcus neoformans nicht nur einen Einblick in die Symptomatik dieses AIDS-assoziierten Krankheitserregers, sondern er enthält auch exemplarisch viele typische Pilzthemen und Empfindungen. Zwanzig Jahre nach seiner Prüfung vermittelt Marco Riefer in der Darstellung von Candida albicans klinisches Erfahrungsmaterial für ein umfangreiches Arzneimittelbild. Misha Norlands LSD-Prüfung wirft Licht auf jene geheimnisvolle dunkle Seite der Pilze, die mit Ekstase wie mit Psychose verbunden ist. Dazu gibt Sigrid Lindemann ein Fallbeispiel, in dem LSD sowohl isopathisch als auch konstitutionell indiziert ist. Als Differenzialdiagnose zu LSD ist der eigentliche Magic Mushroom, Psilocybe caerulescens in Annette Sneevliets Kasuistik nicht ein Heilmittel für eine Psychose, sondern für eine spezielle Form der Depression, dem Burnout. Psilocybin wird aktuell in der Psychiatrie auf seine antidepressive Wirkung untersucht. Anneliese Barthels hat sich mit ihrer Prüfung von Piptoporus betulinus auf homöopathische Weise an der Diskussion um Ötzi und den Birkenporling beteiligt. Während die Wissenschaft eine halluzinogene Wirkung der bei der Gletschermumie gefundenen Pilze ausschließt, finden wir unter den Prüfungssymptomen durchaus Hinweise auf eine drogenartige Arzneireaktion. Unumstritten ist, dass Pilze seit Jahrtausenden sowohl wegen ihrer Rauschwirkung als auch wegen ihrer Heilkräfte von Schamanen und Volksmedizinern in aller Welt geschätzt wurden. Gleichzeitig kennt man sie als Erreger vieler lästiger Hautkrankheiten, die von Rajan Sankaran zu einem eigenen Miasma zusammengefasst wurden. Eine Kasuistik von Ruth Wittassek zeigt dieses Ringworm-Miasma in seiner Eigenart. Als Lebensgemeinschaft von Pilzen und Algen nehmen die Flechten im Zauberreich der Pilze einen besonderen Platz ein. In der Homöopathie kennen wir vor allem Sticta pulmonaria. Willi Neuhold erarbeitet in seinem Artikel die Vitalempfindung dieser Arzneifamilie und gibt uns mit der miasmatischen Zuordnung die Möglichkeit, auch Mittel wie Cetraria islandica oder Cladonia rangifera in der Praxis anzuwenden. Natürlich sind in diesem SPEKTRUM auch die klassischen homöopathischen Arzneien dieser Gruppe vertreten, allen voran Agaricus muscarius. Es ist kein Zufall, dass der Schwerpunkt in Mike Keszlers Fallbeispielen auf neurologischen Störungen liegt, wirkt doch Muscarin, das Gift des Fliegenpilzes, an den cholinergen Synapsen des Nervensystems. Auch von Secale cornutum, dem zweiten großen homöopathischen Pilzmittel, kennen wir die Affinität zu den Nerven. Andreas Holling zeigt Secale allerdings als Mittel gegen Haarausfall mit einer ausführlichen Erörterung des passenden Lepra-Miasmas. Felix Morgenthalers Beitrag zu Bovista ergänzt das homöopathische Wissen über die Mittelgruppe der Fungi durch die Sichtweise von Massimo Mangialavori. Mit der Führung durch das Zauberreich der Pilze präsentiert SPEKTRUM in der Zusammenschau der Beiträge unseres international renommierten Autorenteams ein weiteres, besonders spannendes Kapitel seiner modernen lebendigen Materia Medica. |

|
Anton Kramer, Frans Kusse, Gio Meyer, Marguerite Pelt, Wim Roukema, Enna Stallinga, Rienk Stuut: Suche nach dem Kern
Das Pilzreich - Eine Gruppenanalyse nach Masi mit Differenzialdiagnose und zwei Fallbeispielen |

|
Jan Scholten: Am Ende
Pilze in Periodensystem und Pflanzentheorie |

|
Jörg Wichmann Angelika Bolte Ruth Wittassek: Wesen aus dem Zwischenreich
Pilze – eine Übersicht mit Fallbeispielen zur Empfindungsmethode |

|
Willibald Neuhold: Kargheit und Fülle
Sticta pulmonaria und andere Flechten – eine Symbiose aus Pilzen und Algen |

|
Felix Morgenthaler: Ausdehnung in Zeit und Raum
Bovista – eine ausführliche psychosomatische Fallgeschichte |

|
Mike Keszler: Außer Kontrolle
Agaricus muscarius bei Multipler Sklerose |

|
Andreas Holling: Die Haare sterben ab
Secale cornutum und ein Fall von Alopezie |

|
Misha Norland: Zerfall und Verschmelzung
LSD – bizarre Selbsterfahrungen mit einer Hochpotenz |

|
Sigrid Lindemann: Lucid in the Sky
LSD – ein Fall von isopathischem Konstitutionsmittel |

|
Annette Sneevliet: Mein Gehirn fällt auseinander
Psilocybe caerulescens und ein Fall von Burnout |

|
Anneliese Barthels: Grenzenlos unverblümt
Piptoporus betulinus – eine Pilzprüfung mit Kasuistik |

|
Bob Blair: Entfremdet vom Selbst
Cryptococcus neoformans – Synopsis einer Arzneimittelprüfung |

|
Marco Riefer: Chaos, Hektik, Wut im Bauch
Candida albicans – 20 Jahre homöopathische Erfahrung |
Zauberreich der Pilze - Spektrum Homöopathie 01/2015

Zuzüglich Portokosten:
Deutschland: 1,30 EUR Porto pro Heft
Schweiz: 1,80 EUR pro Heft
Österreich 2,90 EUR pro Heft
Durchschnittliche Kundenbewertung:  185
1854,6 von 5 Sternen 124 Bewertungen (deutsch), 61 Bewertungen (englisch) Top-KommentareNeueste Kommentare zuerst anzeigenJohanna Stahl Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
Homöopathie, eine effektive Medizin
Nach allem, was ich zur Zeit höre, tat es mir sehr gut, die Berichte von Ärzten aus den unterschiedlichsten Ländern zu lesen, die mit Homöopathie den Erkrankten helfen konnten. Sehr beeindruckt hat mich der Artikel über CO2. Weltweit sind alle Menschen betroffen, die eine Maske tragen. Dadurch erhöht sich der CO2-Gehalt im Blut, was für uns Menschen schädlich ist. Es löst Symptome aus, die dann leicht dem Virus untergeschoben werden können. Allen, die an dieser Ausgabe mitgearbeitet haben: Vielen Dank! weiterlesen ... 41 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein NeinBetina Quägber-Zehe M.A. Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
Sehr spannende und informative Lektüre
Als interessierte Nichtmedizinerin (gibt es eine weibliche Form von Laie??) habe ich die Artikel sehr aufmerksam gelesen und finde sie außerordentlich informativ. Zum Glück hat niemand aus unserer Familie bislang Corona, wir nehmen aber schon seit einigen Jahren Influenzinum und sind seither Grippe frei. Ich würde in unseren Breiten auch Bryonia als Genius epidemicus sehen, da es die meisten Übereinstimmungen zeigt. weiterlesen ... 19 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein NeinS. Voege Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
Long Covid: Hervorragend
Ich finde dieses Heft wirklich beachtlich und hervorragend. Die Beiträge zeigen, dass es verschiedene homöopthische Wege aus der Misere gibt, wenn man von Covid bzw. der Impfung dagegen betroffen ist. Das nimmt ganz viel Angst und gibt die Sicherheit, so eine Krise gut durchstehen zu können. Herzlichen Dank an die Autor:innen für ihre Suche nach entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten und dass sie ihr Wissen in Worte gefasst und veröffentlicht haben. Dieses Heft ist auch für Laien interessant und absolut empfehlenswert. weiterlesen ... 18 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein Neinsimone Verifizierter Kauf

vor 7 Jahren
Empfehlenswerte Fachliteratur
Sehr informativ, sowohl für "Neulinge" in der Homöopathie als auch für erfahrene Homöopathen. Insgesamt sehr empfehlenswert. weiterlesen ... 18 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein Neineine Leserin Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
Bin begeistert!
Inzwischen habe ich schon etliche Hefte von "Spektrum der Homöopathie" gelesen und bin von jedem Heft begeistert. Durch die Lektüre habe ich ein Verstehen für das jeweilige Thema bekommen, das ich vorher nicht hatte, und das in kurzer Zeit, weil das Grundsätzliche und Wichtige gut strukturiert und interessant aufbereitet ist. Außerdem fühle ich Herzblut hinter dieser Zeitschrift, was sehr motivierend auf mich wirkt. Vielen Dank, dass es sie gibt! weiterlesen ... 14 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein NeinIris PH

vor 3 Jahren
Genius epidemicus
Letzte Woche kam das neue Spektrum- Heft "Genius epidemicus - Homöopathie in Zeiten der Pandemie" an und ich habe mich gleich drauf gestürzt. Das ist so wertvoll, diese wunderbaren Erfahrungen der KollegInnen (auf der ganzen Welt) so komprimiert studieren zu können. Danke dafür bei dieser Gelegenheit. Euer Spektrum-Team macht eine einmalige Arbeit, die ich sehr schätze! weiterlesen ... 13 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein NeinM. Sandvoss Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
wichtige Informationen
Ein sehr gehaltvolles, gelungenes Heft. Auch hinsichtlich der allgemeinen Corona-Politik, die bislang versuchte, die Homöopathie zu ignorieren. weiterlesen ... 10 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein NeinSusanna Indermühle Verifizierter Kauf

vor 3 Jahren
Sehr Informativ
Ich bin beeindruckt von den spannenden, sachlich fundierten Artikeln. Was mich auch sehr überzeugt, ist das fehlen von Werbung im Heft. Da bezahle ich gerne den Preis, weil ich dann das Gefühl der Echtheit habe und nicht der Werbebasierten Artikel. weiterlesen ... 5 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein Neindr.b.stahlheber Verifizierter Kauf

vor 7 Jahren
Rheumabehandlung nicht einfach
mit diesem Spektrumsheft habe ich wieder neue Aspekte die ich bei der Behandlung berücksichtigen werde weiterlesen ... 5 Personen finden das hilfreich. Finden Sie das hilfreich?
 Ja Ja Nein Nein |
||||||




















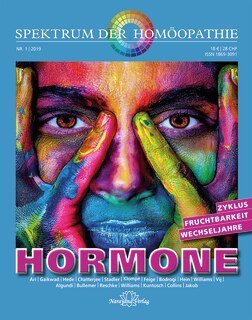
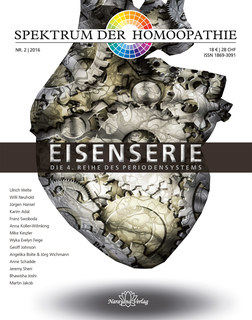
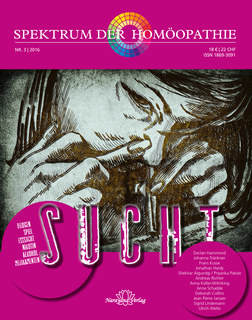
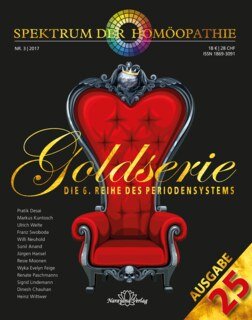

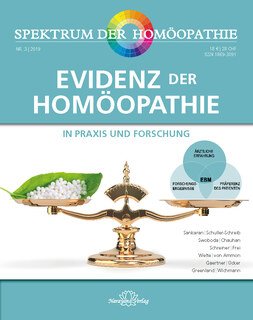



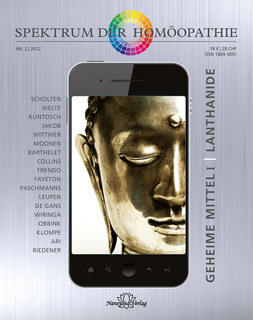



Das Infekt-Spektrum ist eines der besten Hefte, die ich erinnere. So viele schlüssige Zugänge zum Mittel, alles von kompetenten Autoren geschrieben, so viele gute Facetten gibt es sonst nirgends in einer Zeitschrift. Jeder Artikel ist schlüssig und aufschlussreich.
Besonders gefallen haben mir die Tipps der erfahrenen Ute Bullemer, die ich bisher nicht kannte; ich werde an Anantherum denken bei der häufigen Portioerosion; Erodium ist übrigens auch öfters gut.
Heiner Freis Methode ist schlüssig dargestellt, bei uns längst dankbare Ergänzung des Alltags.
Super fand ich die Darstellung von T. Curtis über die Zitterpappel, die sie sehr schön schildert und durch Fälle belegt, die dann auch durch die Pflanzentheorie erklärbar sind: tolle Arbeit.
D. Payrhuber hat auch sehr schöne Fälle, vor allem die beiden Helleborus Fälle.
Auch Rajan Sankarans Pulsatilla Fall deckt sich mit unseren besten Puls-Fällen, sie sind nämlich nicht nur so sanft wie immer behauptet wird: diese Eigenschaft ist ein Teil des Bildes und entspricht Stadium 2. Die Tatsache, dass die Patientin empört einen Rikshafahrer ohrfeigte, fand ich interessant, denn es stimmt: die Ranunculaceae sind alle mehr oder weniger schnell empört und so gereizt, dass sie auch zuschlagen könn(t)en, wie man es von Staph kennt. Auch das innere oder äußere Zittern oder Beben gehört zu allen Ranunceln.
Franz Swoboda hat mich mit seinem ausgezeichneten Artikel sehr zum Lachen gebracht. Ergänzend wäre zu sagen, dass die Quintessenz seiner „Epidemie“ auch in Jan Scholtens Elementen beschrieben wird: Ant-t hilft praktisch in allen Fällen von chronischer Bronchitis mehr oder weniger (das hat er sonst von keinem Mittel so behauptet, und es stimmt), aber es heilt nicht. Vor allem seine neue Beobachtung der Mycoplasmennosode als Pendant ist sehr interessant.
Dann der Choleraartikel: einfach Super, das beste was ich über die Cholera bisher gelesen habe. Gerade die gute Widerlegung, dass nur das Meiden von Aderlässen und die (geringe) Flüssigkeitszufuhr der einzige Grund für die unbestreitbare Überlegenheit der damaligen homöopathischen Behandlungen sei, fand ich sehr schlüssig.
Dann die Iquilai Studie: wo findet man so was heute? Erstklassig.
Selbst Kate Birchs Birkentrunk für alle Impfprobleme fand ich interessant, auch wenn man sagen muss, dass man es sich auch selbst unnötig schwer machen kann durch zu viele theoretische Erwägungen. Man versteht zumindest, warum so alles in einen Trank gepackt werden muss. Immerhin ein schöner Fall.
Die Mollusken von Fr. Schuller-Schreib sind auch lohnenswert. In diesem Zusammenhang auch der Calc-Fall von K Adal.
Dann auch der Hinweis auf den Index am Schluss: ein Super-Heft. weiterlesen ...